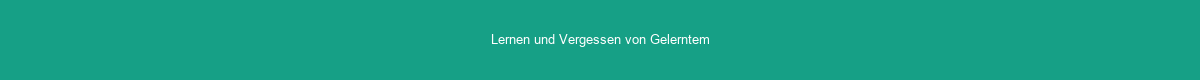Beim Vergessen spielen zwei Phänomene eine zentrale Rolle: das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Damit sich eine Erinnerung festigen kann, muss sie vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportiert werden (Konsolidierung), wobei die Konsolidierung ein dynamischer Prozess ist. Wenn die Erinnerung wieder hervorgerufen wird, wird sie im Kurzzeitgedächtnis neu aktiviert, aber um dann wieder ins Langzeitgedächtnis übertragen zu werden, muss sie aufs Neue konsolidiert werden (Rekonsolidierung). Während der Rekonsolidierung kann die Erinnerung verändert werden und kann theoretisch dabei auch vergessen werden.

Wie man weiß, reicht Zeit alleine zum Vergessen nicht aus, sondern Vergessen ist eine aktiver Prozess, der durch zeitabhängige Veränderung der Enkodierspezifität zustande kommt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Passung, die sowohl eine Rolle beim Erinnern als auch beim Nicht-Erinnern spielt. Eine Gedächnisspur verschwindet in der Regel nicht, sie lässt sich bloß nicht mehr so gut auffinden. Das Gehirn ist durch eine enorme Plastizität charakterisiert, d. h., es bildet ständig neue synaptische Verbindungen zwischen Nervenzellen und baut diese wieder ab. Aber nicht nur Lernprozesse führen zu Veränderungen in der Verschaltung von Nervenzellen im Gehirn, sondern auch beim Abrufen einer Erinnerung laufen ähnliche molekulare Prozesse ab wie bei der Gedächtnisbildung selbst, sodass jede Erinnerung zu einer Veränderung der Gedächtnisspur führt. Lang anhaltende Lernprozesse führen sowohl zu Änderungen in der Genexpression auf molekularer Ebene als auch zu direkten Veränderungen des Aussehens der beteiligten Neuronen im Gehirn. Mit der Zwei-Photonen-Mikroskopie lassen sich diese strukturellen Änderungen an Neuronen direkt beobachten, wobei jene tausendstel Millimeter großen Dornen auf den neuronalen Fortsätzen mit dieser Methode fluoreszierend dargestellt werden, die den Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen entsprechen. Eine vermehrte Ausbildung von Dornenfortsätzen sind daher mögliche Zeichen des Langzeitgedächtnisses, wobei nach neuesten Untersuchungen einige der molekulare Prozesse beim Erinnern jenen bei der Bildung des Gedächtnisses zwar ähnlich sind, doch bleibt beim Erinnern die sichtbare Struktur der synaptischen Verbindungen weitgehend unverändert.
Vergessen findet auch durch Interferenz statt, etwa durch Quellenkonfusion, d.h., dass bestimmte Ereignisse einander ähnlich sind und man nicht mehr weiß, welche Erinnerung zu welchem Ereignis gehört. Interferenz kann auch durch eine Konkurrenz zwischen ähnlichen Gedächtnisspuren zustande kommen bzw. dass sich die einzelnen Ereignisse miteinander vermischen und man nichts mehr findet. Bei retroaktiven Interferenzen sorgen spätere Gedächnisspuren darfür, dass frühere Spuren nur noch erschwert aufgefunden werden, während bei proaktiven Interferenzen frühere Gedächisspuren spätere Gedächnisspuren stören. Interferenz kann auch über die Generalisierung stattfinden, indem man altes Wissen auf neue Situationen überträgt. Es gibt daher zwei Strategien, um Interferenzen entgegen zu wirken: zum einem beim Enkodieren durch das Erzeugen von distinkten Gedächnisspuren und zum anderen beim Zugriff, durch Unterdrückung (Inhibition) von ungewollten Gedächnisspuren. Beim Enkodieren sollte man möglichst auffällige Informationen mit abspeichern, damit man somit distinkte Gedächnisspuren erzeugt, die dafür sorgen, dass man später die richtige Information wiederfindet. Während des Gedächniszugriffs kann eine Interferenz auch durch einen inhibitatorischen Mechanismus unterdrückt werden, bei dem stärkere Spuren zugunsten von schwächeren Spuren unterdrückt werden. Zugriffsbedingtes Vergessen bezeichnet den Zustand, wenn mehrere Informationen mit dem gleichen Zugriffssignal assoziert sind und der erste Zugriff die folgenden erschwert.
Es gibt zwei Möglichkeiten auf Gedächnisspuren zuzugreifen, den aktiven Zugriffsprozess als Erinnern und das Gefühl der Vertrautheit, d.h., das Wiedererkennen. Das Gefühl der Vertrautheit kommt etwa beim Erinnern an ein gelerntes Wort auf und nicht als bewusste Erinnerung, wobei das Wiedererkennen nicht auf eine Repräsentation angewiesen ist, die den kompletten Kontext enthält, sondern es kann sowohl in Teilen oder sogar gänzlich kontextfrei erfolgen. Eine wichtige Konsequenz aus dem impliziten Gedächnis und dem Gefühl der Vertrautheit ist die erhöhte Verarbeitungsflüssigkeit.
Mit Hilfe von Mnemotechniken kann man sein Gedächnis verbessern, wobei bestinmmte Enkodierschemata wie z.B. die Methode der Orte verwendet werden. Der Effekt beruht auf einer Kombination mehrere Prinzipien, zum einen des bedeutungsvollen Hervorhebens, das als der Versuch, eine einzigartige Erinnerung zu schaffen gewertet werden kann, mit dem auch Interferenzen unterdrückt werden, zum anderen durch identische Enkodier- und Abrufstrukturen, also durch optimale Passung. Die Mnemotechniken sind insbesondere gut geeignet für Informationen, die wenig Struktur besitzen und somit von der Enkodier- und Abrufstruktur abhängig sind. Auch das Lernen mittels Prüfungsfragen führt zu besseren Lernleistungen, da auf das Wissen aktiver zugegriffen wird, sich somit Verknüpfungen zwischen dem Material und den potentiellen Fragestelungen bilden, wodurch die Fragen selbst zu Zugriffssignalen werden, d.h., eine hohe Enkodierspezifität erreicht. Eine Verteilung des Lernens führt in der Regel ebenfalls zu besseren Lernleistungen (Verteilungseffekt), aber durch das Gefühl der Vertrautheit, das eine Beherrschung des Lernstoffes vortäuscht, kann der Lerneffekt behindert werden. Bei längeren Pausen hingegen verringert sich das Gefühl der Vertrautheit und das Material wird nochmals aktiver verarbeitet.